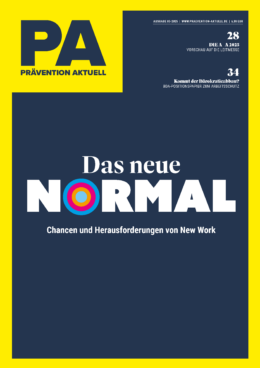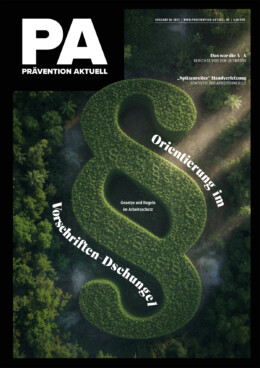- Editorial
- Praxis
- Produkte & Märkte
Gesund bleiben zwischen Homeoffice und Büro
Mehr Bewegung im hybriden Arbeitsalltag

Illustration: Hanna – stock.adobe.com
Hybrides Arbeiten bringt Flexibilität – aber auch neue Herausforderungen für die Gesundheit. Gerade das Bewegungsverhalten leidet, wenn Beschäftigte zwischen Büro und Homeoffice wechseln. Fachleute für Gesundheitsschutz und Prävention erklären, worauf es jetzt ankommt.
Um alle spannenden Reportagen zur Arbeitssicherheit, Gesundheitsprävention und nachhaltigem Arbeiten unbeschränkt lesen zu können, registrieren Sie jetzt für einen Gratismonat – läuft automatisch aus!